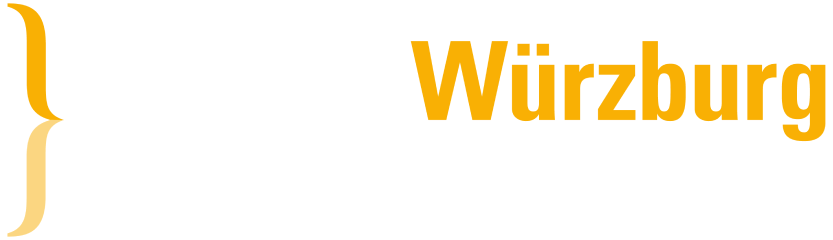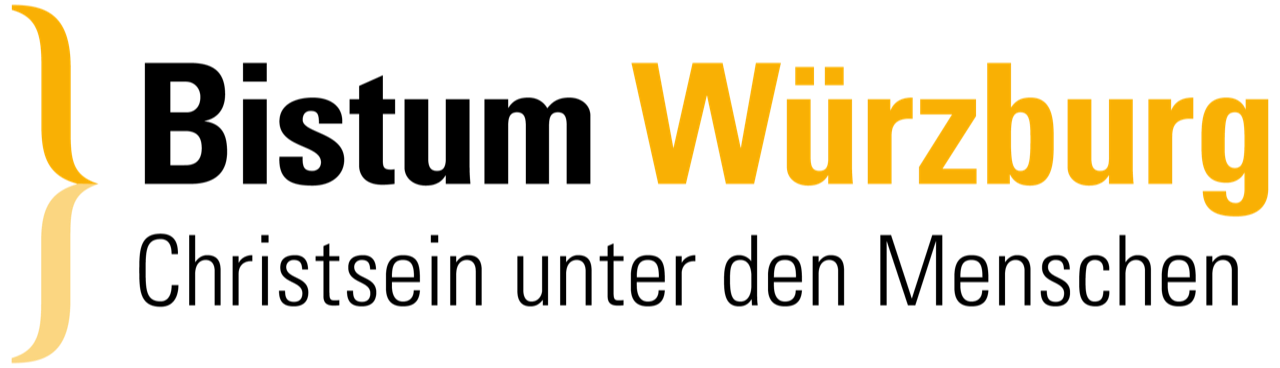Würzburg (POW) Das Thema ist alt, aber aufgrund aktueller Kriege in der Ukraine und in Nahost aktuell: Gibt es einen gerechten Krieg? Mit dem komplexen Thema hat sich am Donnerstag, 3. Juli, der Moraltheologe Professor Dr. Tobias Winright von der katholischen Saint Patrick’s Pontifical University im irischen Maynooth auseinandergesetzt. Bei der „Kiliani-Lecture“ im Würzburger Burkardushaus sprach er in seinem auf Englisch gehaltenen Vortrag über gerechten Krieg und gerechten Frieden aus Sicht der katholischen Ethik. Winright machte deutlich, dass er weder absoluten Pazifismus für richtig halte, noch Krieg ohne eine wirkliche Perspektive für die Zeit danach für richtig erachte. „Glauben Sie mir: Dafür bekomme ich – vor allem aus den USA – täglich jede Menge schlimme E-Mails.“
Das Thema der verantwortlichen Anwendung von (staatlicher) Gewalt beschäftige ihn seit seiner Zeit als Beamter in Strafvollzug und Polizei in seiner Heimat USA, berichtete Winright. Dass es mitunter notwendig sei, auch Waffen einzusetzen, um Schwache zu schützen, sei ihm bewusst. „Meine Tochter hat einen Amoklauf an ihrer amerikanischen Schule überlebt. Der Angreifer hat ein Sturmgewehr benutzt. Ihr blutverschmiertes Kleid war Beweisstück vor Gericht.“
In seinem Vortrag schlug Winright einen Bogen vom frühen Christentum bis zu Papst Leo. Letzterer betonte vor wenigen Tagen: „Krieg löst keine Probleme, er verstärkt sie vielmehr und verursacht tiefe Wunden in der Geschichte von Menschen. Ihre Heilung dauert Generationen. Kein bewaffneter Sieg wiegt den Schmerz der Mütter auf, die Furcht der Kinder, die gestohlene Zukunft.“ Ähnlich habe sich Papst Franziskus beispielsweise in „Fratelli Tutti“ geäußert. Krieg könne nicht mehr als Lösung betrachtet werden, denn seine Risiken „werden wahrscheinlich immer größer sein als der vermeintliche Nutzen“.
Der frühchristliche Kirchenlehrer Tertullian habe beispielsweise die Ansicht vertreten, dass Jesus, indem er im Garten Getsemani Petrus das Schwert entriss, jedem Soldaten die Waffe abgenommen habe. Das gelte insbesondere, da aus Tertullians Sicht zu dieser Zeit jeder Dienst für den heidnisch göttlichen Kaiser Götzendienst war. Auch die vermutlich um 500 in Ägypten entstandene Kirchenordnung „Kanones des Hippolyt“ untersagte ausdrücklich jedem, dem die Macht zu töten erteilt sei, das Töten – „auch wenn sie dazu den Befehl erhalten haben“. Der heilige Augustinus habe den Blick darauf gerichtet, dass der Frieden das Objekt der Begierde sein solle. „Huldige daher selbst im Krieg dem Geist eines Friedensstifters, damit du, indem du die besiegst, die du angreifst, diese zurück zu den Vorteilen des Friedens führen kannst.“
Ein gerechter Krieg, so habe der heilige Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert erklärt, brauche einen gerechten Grund und die rechte Absicht. Nicht zulässig seien in diesem Zusammenhang in sich böse Handlungen. Wichtig sei zudem, dass das dadurch erreichte Gute das Schlechte der Waffengewalt überwiege. Im 20. Jahrhundert habe der amerikanische Moraltheologe John A. Ryan zudem festgehalten: „Nach den Worten des Pazifisten ist jegliche Anwendung von Gewalt unter Nationen unmoralisch. Diese Annahme findet aber weder im Gesetz der Offenbarung noch im Naturgesetz Unterstützung.“ Das habe auch Papst Pius in einer Ansprache 1956 unterstrichen, als er sagte: „Ein katholischer Bürger kann sein eigenes Gewissen nicht anführen, um sich der Erfüllung der Pflichten zu entziehen, die das Gesetz auferlegt, wenn seine Nation sich legitim mit Waffen verteidigt.“ Papst Johannes XXIII. hingegen habe, auch unter dem Eindruck der atomaren Bedrohung, in seiner Enzyklika „Pacem in Terris“ betont, dass die Menschheit zunehmend zur Überzeugung gelange, dass Konflikte zwischen Nationen besser durch Verhandlungen zu lösen sind als durch Waffengewalt.
Die gegenwärtige Theorie des gerechten Kriegs umfasst laut Winright drei Aspekte: einen gerechten Grund, in den Krieg zu ziehen, gerechtes Benehmen im Krieg und Gerechtigkeit nach dem Krieg. „Wer in den Krieg zieht, darf das nur als letzten Weg machen. Es muss verhältnismäßig sein, ein Erfolg muss wahrscheinlich sein“, betonte der Moraltheologe. Wichtig sei bei der Kriegsführung, dass die Zivilbevölkerung bestmöglich geschützt werde. Nach dem Krieg sei es unerlässlich, beim Wiederaufbau zu helfen.
Unter diesen Aspekten seien auch die Äußerungen von Papst Franziskus zum Krieg in der Ukraine zu verstehen, der unter anderem sagte, dass Selbstverteidigung erlaubt und ein Ausdruck der Liebe zum Heimatland sei. „Wer sich nicht selbst, wer nicht etwas verteidigt, liebt es nicht. Wer etwas verteidigt, liebt es.“ Zugleich habe Papst Franziskus an anderer Stelle betont, dass Krieg immer eine „Niederlage der Menschlichkeit“ sei: „Kein Krieg ist den Verlust auch nur eines menschlichen Geschöpfs wert; eines Wesens, das nach dem Bild und Abbild des Schöpfers geschaffen ist.“
„Ich halte es mit meinem Kollegen David Carroll Cocheran, der sagt: Dieses Gebiet der kirchlichen Lehre ist noch relativ fluide. Das betrifft insbesondere die vielen unbeantworteten Fragen, vor allem wenn es darum geht, ob und wann Waffengewalt moralisch erlaubt ist.“ Ein wichtiger Weg sei, wie von der US-amerikanischen Bischofskonferenz angeregt, gewaltfreie Wege zum Eindämmen von Aggression und zur Konfliktlösung zu entwickeln. So spiegele sich am besten gleichzeitig Jesu Aufruf, Friedensstifter zu sein, und der Aufruf zur Gerechtigkeit wider. „Sowohl unbewaffnete als auch bewaffnete Ansätze müssen darauf zielen, gerechten Frieden zu schützen und aufrechtzuerhalten. Maßstab für beide Ansätze muss es sein, Schaden zu begrenzen“, betonte Winright.
mh (POW)
(2825/0704; E-Mail voraus)
Hinweis für Redaktionen: Fotos abrufbar im Internet